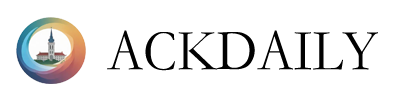Ein Model auf der Flucht vor der eigenen Perfektion, ein Leichenpräparator, der den Tod malt – und ein Film, der ihre Welten in neonheller Nacht kollidieren lässt: „White Snail“ machte Elsa Kremser und Levin Peter auf einen Schlag international bekannt. Ihr Film wurde im internationalen Wettbewerb des Locarno Film Festivals uraufgeführt und mit dem Spezialpreis der Jury ausgezeichnet. Ihre beiden Hauptdarsteller Marya Imbro und Mikhail Senkov – beide Laiendarsteller – erhielten gemeinsam den „Pardo for Best Performance“. Schon das Drehbuch folgte einem ungewöhnlichen Ansatz: Es legte nur Situationen und Entwicklungen fest, ließ aber die Dialoge offen. „Wir kannten Marya und Mikhail so gut, dass wir wussten, wie sie sprechen und reagieren würden“, erklärt Levin Peter.
 Video abspielen
Video abspielen
Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden
YouTube öffnenInhalte Dritter
Wir verwenden YouTube, um Inhalte einzubetten, die möglicherweise Daten über deine Aktivitäten erfassen. Bitte überprüfe die Details und akzeptiere den Dienst, um diesen Inhalt anzuzeigen.
Einverständniserklärung öffnenPiwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.
Dass Senkov im Film in einer Leichenhalle arbeitet, ist kein Zufall – er tut es auch im wirklichen Leben. Kremser begegnete ihm vor zehn Jahren in der belarussischen Hauptstadt Minsk und stand bald darauf in seiner Wohnung, deren Wände dicht behängt waren mit Ölgemälden. Die Bilder zeigten Tote, doch nicht als starre Abbilder. „Sie wirkten eigenartig lebendig, zugleich verletzlich und von einer unerwarteten Zärtlichkeit geprägt“, erinnert sich Kremser. „Misha feiert in seinen Bildern die Vergänglichkeit und zeigt, dass jeder Körper irgendwann zerfällt.“ Aus dieser Erfahrung entstand die Idee zu White Snail.
Verschränkung von Dokumentation und Fiktion
Der Film greift Elemente aus den Biografien seiner Darsteller auf, führt sie jedoch in eine andere, verdichtete Wirklichkeit. Während Senkovs Malerei den Tod in poetische Formen übersetzt, verkörpert Imbro als Model die Welt des Makellosen – eine Rolle, die auch auf ihr echtes Leben verweist, denn Imbro steht tatsächlich als Model vor der Kamera. Doch hinter der perfekten Oberfläche liegt Verletzlichkeit: Depressionen, Selbstzweifel und Suizidgedanken prägen ihre Figur. White Snail bringt diese scheinbar gegensätzlichen Lebenswelten zusammen – und stellt dem gesellschaftlichen Streben nach Perfektion die Erfahrung von Zerfall und Endlichkeit gegenüber.
Visuell prägte Minsk die Bildsprache des Films. „Wir hatten die Stadt mit grauen Plattenbauten assoziiert“, erzählt Levin Peter. „Vor Ort entdeckten wir die wilden Farben der Nächte, die futuristischen Satellitenstädte, die Einkaufszentren voller Neonlicht.“ Viele Szenen wurden ausschließlich mit vorhandenem Licht gedreht: Neonröhren, Straßenlaternen, Handydisplays. So entstand eine Ästhetik zwischen dokumentarischer Direktheit und poetischem Leuchten.
Deutsch-österreichische Zusammenarbeit
Die Zusammenarbeit von Elsa Kremser und Levin Peter war von Beginn an grenzüberschreitend. Beide studierten an der Filmakademie Baden-Württemberg, gründeten 2016 in Wien ihre Produktionsfirma Raumzeitfilm – und bewegen sich seither selbstverständlich zwischen Österreich und Deutschland. Diese Doppelverankerung prägt auch ihre Produktionsweise. „In Österreich wird das künstlerische Kino stärker von kommerziellen Arbeiten getrennt und genießt mehr Beachtung“, sagt Kremser. Deutschland bleibt dennoch ein fester Bestandteil: Ihre Filme entstehen stets in enger Kooperation mit regionalen Förderprogrammen und Sendern wie ZDF oder ARTE. Eine klassische Arbeitsteilung gibt es dabei nicht. Ideenentwicklung, Finanzierung, Drehbuch – alle Entscheidungen entstehen im Dialog. Ihre Filme tragen eine gemeinsame Handschrift.
Europäische Talentprogramme
Wichtige Impulse erhielten Kremser und Peter durch europäische Talentprogramme. Sie erhielten ein Kompagnon-Fellowship, durchliefen das TorinoFilmLab und wurden später von Eurimages gefördert. Für Peter sind diese Plattformen vor allem ein Ort des intensiven Austauschs: „Die Diskussion mit anderen internationalen Regisseurinnen und Regisseuren und das gegenseitige Lesen der Drehbücher kann sehr bereichernd sein und eigene Projekte voranbringen.“
Mehr Geld für Filmförderung in Deutschland
Neue Dynamik kommt derzeit aus Berlin: Kulturstaatsminister Wolfram Weimer kündigte an, die Bundesmittel für Filmförderung 2026 nahezu zu verdoppeln – künftig sollen jährlich 250 Millionen Euro zur Verfügung stehen, um Planungssicherheit zu schaffen und internationale Produktionen zu stärken. Kremser und Peter begrüßen diesen Schritt und hoffen, dass dadurch viele Filmschaffende die Unterstützung erhalten, die sie für ihre Arbeit brauchen.