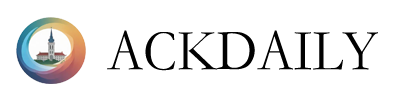Nazeeha Saeed lebt seit 2016 im Exil – zuerst in Paris, heute in Berlin. In ihrer Heimat Bahrain konnte sie als Medienschaffende nicht mehr arbeiten. Dabei hatte sie schon als Kind davon geträumt, Journalistin zu werden. In Bahrain berichtete sie viele Jahre über Themen wie Menschenrechte, politische Entwicklungen und Genderfragen – zunächst für lokale, später für internationale Medien. Doch im Zuge des Arabischen Frühlings 2011 veränderte sich alles. Auf die Proteste, bei denen Menschen mehr Rechte und Demokratie forderten, reagierte die Regierung hart. Saeed verlor ihre Lizenz zum Arbeiten und wurde sogar in Polizeigewahrsam genommen und erheblichen Repressalien ausgesetzt, weil sie über die Proteste berichtete. Die Initiative „Reporter ohne Grenzen“ bestätigt in ihren Länderberichten, dass viele Journalisten und Journalistinnen in Bahrain aufgrund von Vorwürfen wie Teilnahme an Demonstrationen, Zerstörung von Eigentum oder Terrorunterstützung zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurden. Doch Saeed wollte sich nicht zum Schweigen bringen lassen und entschied sich ins Exil zu gehen. „Die Verhaftung hat mir gezeigt, wie wichtig meine Stimme ist – und unabhängiger Journalismus, Presse, die nicht staatlich oder wirtschaftlich kontrolliert ist und ohne politische Einflussnahme berichtet“, erzählt sie.

Diese Erfahrungen prägten ihre Haltung nachhaltig: „Mein journalistisches Prinzip ist heute mehr denn je: Steht das, worüber ich berichte, im Einklang mit den Menschenrechten oder nicht? Das ist mein Kompass, egal, worum es geht.“
Ein neuer Anfang dank gezielter Unterstützung
In Deutschland setzt Nazeeha Saeed ihre Arbeit als Journalistin fort. Dabei halfen ihr Programme wie das „Journalists-in-Exile“-Programm des European Centre for Press and Media Freedom (ECPMF). Ziel des Programms ist es, Exil-Journalistinnen und -Journalisten zu ermöglichen, auch in Deutschland ihrer Arbeit nachzugehen und neue Perspektiven für ihre Zukunft zu entwickeln.
Das ECPMF ist eine gemeinnützige Organisation mit Sitz in Leipzig, die 2015 gegründet wurde. Grundlage ihrer Arbeit sind die Europäische Charta der Pressefreiheit sowie die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Das Zentrum verfolgt die Vision einer Gesellschaft, in der Medienfreiheit einen offenen Diskurs ermöglicht und alle Menschen Informationen frei suchen, empfangen und weitergeben können. Die Mission des ECPMF ist es, die Medienfreiheit zu fördern, zu schützen und zu verteidigen. Dazu gehört auch das Dokumentieren von Verstößen, die praktische Unterstützung von Medienschaffenden und die Vernetzung unterschiedlicher Akteurinnen und Akteure in ganz Europa.
Ein wichtiger Baustein dieser Arbeit ist das Journalists-in-Exile-Programm. Es richtet sich an Medienschaffende, die aufgrund von Verfolgung oder Repression ihr Herkunftsland verlassen mussten. „Die Journalist*innen bringen fundiertes Wissen, langjährige Erfahrung und wertvolle Perspektiven mit“, erklärt Katrin Schatz, Managerin des Programms. „Gleichzeitig stehen sie in Deutschland vor Hürden – vom prekären Aufenthaltsstatus über den eingeschränkten Zugang zu Redaktionen bis hin zu fehlenden Netzwerken.“
Das Programm bietet eine breite Palette an Unterstützung: Sprachkurse, juristische Beratung, psychosoziale Hilfe, Weiterbildungen oder Zuschüsse für technische Ausrüstung. „Wir arbeiten bewusst ohne Bewerbungsfristen und passen die Unterstützung flexibel an die individuellen Bedarfe an“, so Schatz. „Ein stabiler Aufenthalt ist die Basis für alles Weitere. Deshalb unterstützen wir auch bei rechtlichen Fragen und übernehmen, wo nötig, anwaltliche Kosten.“
Besonders für Journalistinnen und Journalisten aus der arabischen Region ist das Programm eine wichtige Brücke, um an ihre frühere Arbeit anzuknüpfen. „Damit der Wiedereinstieg gelingt, braucht es nicht nur finanzielle und aufenthaltsrechtliche Sicherheit, sondern auch diskriminierungssensible Zugänge zu Redaktionen, Förderangeboten und öffentlichen Diskursen“, betont Schatz. Das Programm steht allen Medienschaffenden offen, die aufgrund von Verfolgung oder Repression ihr Herkunftsland verlassen mussten – unabhängig von ihrer Herkunft.
Erfahrungen in Deutschland
In Deutschland hat Saeed erfahren, was Pressefreiheit bedeuten kann. „Ich hatte immer das Gefühl, frei berichten zu können – über lokale Ereignisse ebenso wie über die arabische Diaspora.“ Dennoch warnt sie davor, Pressefreiheit als selbstverständlich zu betrachten: „Pressefreiheit darf nicht relativ sein. Sie darf nicht nur dann gelten, wenn es um ‚genehme‘ Themen geht.“
Als besonders angespannt werde von vielen Journalisten und Journalistinnen aus dem arabischen Raum die Situation in der Berichterstattung über die anhaltenden Kriegsverbrechen Israels gegen Palästinenserinnen und Palästinenser empfunden, berichtet Schatz. „Viele Journalist*innen erleben einen spürbaren Druck, sich selbst zu zensieren, um den Zugang zu Aufträgen nicht zu verlieren“, sagt sie. Seead erklärt: „Gewisse Formulierungen werden vermieden, bestimmte Perspektiven ausgeklammert, vor allem pro-palästinensische Stimmen. Die Richtung sollte uns zu denken geben.“
Für ihr Engagement wurde Saeed 2014 mit dem Johann-Philipp-Palm-Preis für Meinungs- und Pressefreiheit ausgezeichnet. „Wenn man aus einem kleinen Land kommt, wo alle Angst vor der Regierung haben, dann ist es unglaublich ermutigend, wenn eine internationale Organisation sagt: ‚Gut gemacht, deine Arbeit zählt.‘“
Neben ihrer journalistischen Arbeit engagiert sich Saeed auch in der Ausbildung von Journalistinnen. Seit ihrer Verhaftung in Bahrain beschäftigt sie sich intensiv mit dem Thema Sicherheit für Medienschaffende, insbesondere in Konflikt- und Protestsituationen. Seit 2017 bietet sie zudem Workshops zur gendersensiblen Berichterstattung auf Arabisch an – bislang für über 300 Journalistinnen und Journalisten.
Ihr beruflichen Pläne für die Zukunft sind klar: „Ich möchte unabhängig bleiben und weiterhin über das berichten, was oft übersehen wird.“