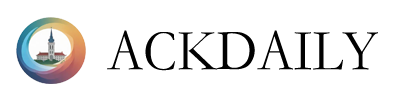Das größte Ausgabenprogramm der neueren deutschen Geschichte hat vergangene Woche seine letzte Hürde genommen. Bundestag und Bundesrat beschlossen in Sondersitzungen das 500 Milliarden Euro schwere Sondervermögen für die Infrastruktur und einen Blankoscheck für Verteidigungsausgaben. Die neue Bundesregierung muss, sobald sie feststeht, noch ein Gesetz beschließen, dass die Details regelt, aber die generelle Schuldenaufnahme ist ihr jetzt bereits erlaubt.
Der Bundesrechnungshof bezeichnet das etwa als „volkswirtschaftliches und soziales Risiko“. In der Kritik steht vor allem, dass die enormen Schulden auch irgendwann wieder getilgt werden müssen. Wie, das ist jetzt noch nicht bekannt. Es wird Teil des Ausführungsgesetzes werden, dass eine neue Bundesregierung noch beschließen muss. Es lässt sich aber schon absehen, wie das aussehen könnte.
So nimmt ein Staat Kredite auf
Um die enormen Ausgaben zu finanzieren, hat der Staat zwei Möglichkeiten. Eine, die etwa die CDU/CSU im Wahlkampf ins Spiel brachte, sind Partnerschaften mit Unternehmen und Investoren. Nach Vorstellung des designierten Kanzlers Friedrich Merz (CDU) könnte etwa ein privates Unternehmen mit Förderung des Staates ein Stück Autobahn bauen und dafür dann das Recht erhalten, dort über einen bestimmten Zeitraum eine Maut zu erheben. So etwas gibt es etwa schon an einigen Stellen in Norddeutschland. Das würde die Ausgaben des Bundes senken.
Mehr aus dem Bereich Wirtschafts-News
Meistgelesene Artikel der Woche
Die zweite Möglichkeit sind Kredite. Die muss die Finanzagentur des Bundes aufnehmen. Sie gibt dafür fast ausschließlich neue Staatsanleihen aus. Das sind Schuldscheine, die für einen bestimmten Betrag verkauft werden und eine bestimmte Laufzeit besitzen, meist zwischen ein und 30 Jahren. Der Staat verpflichtet sich, den Besitzern dieser Anleihen über die Laufzeit jedes Jahr einen Zins zu zahlen und zusätzlich am Ende der Laufzeit den Kaufbetrag zu erstatten. Die Zinssätze schwanken derzeit etwa zwischen 2,1 und 3,2 Prozent je nach Laufzeit.
Deutschland besitzt bei Rating-Agenturen die Topnote AAA
Gerechnet mit dem Mittelwert ergäbe das bei 500 Milliarden Euro Krediten allein für die Infrastruktur also Zinskosten von 13,25 Milliarden Euro pro Jahr. Allerdings werden nicht alle Kredite sofort jetzt aufgenommen, sondern verteilt bis 2035. In dieser Zeit können die Zinssätze also noch in beide Richtungen schwanken. Aktuell ist die Tendenz sinkend, weil die EZB die Leitzinsen noch weiter senken wird.
Deutschland wird sich damit bei denjenigen verschulden, die diese Staatsanleihen aufkaufen. Das kann technisch jeder von Ihnen sein, die größten Batzen sichern sich aber meist institutionelle Anleger. Das sind etwa Pensions- und Rentenversicherungen, große Investmentbanken und ausländische Staatsfonds wie aus Norwegen oder Saudi-Arabien. Sie alle schätzen an deutschen Staatsanleihen, dass wir als sehr kreditwürdig gelten. Als einer von wenigen großen Industriestaaten besitzt Deutschland bei allen drei großen Rating-Agenturen die Topnote AAA. Auch, wenn es anderswo höhere Zinsen geben mag, ist die Rückzahlung deutscher Staatsanleihen damit so gut wie sicher.
So werden die Kredite aus dem Sondervermögen getilgt
Da die Kredite über Staatsanleihen mit einer Laufzeit von maximal 30 Jahren laufen, werden sie also auch über diesen Zeitraum wieder abbezahlt. Wann genau, hängt davon ab, wie viele Kredite mit welcher Laufzeit die Finanzagentur des Bundes ausgibt. Die letzten Kredite dürften demnach aber 2065 getilgt werden.
Aber: Damit sind die Schulden aus dem Sondervermögen nur technisch abbezahlt. Der Schuldenberg Deutschlands wird sich dadurch nicht wieder um 500 Milliarden Euro reduzieren. Tatsächlich schmilzt er nur äußerst selten, denn dazu müsste der Staat einen Überschuss erwirtschaften. Das war zwischen 2013 und 2019 der Fall, als insgesamt rund 160 Milliarden Euro Schulden abgebaut wurden. Es ist aber die Ausnahme. In der Regel ersetzt die Finanzagentur des Bundes auslaufende Staatsanleihen nur durch neue. Vergangenes Jahr tilgte der Bund etwa Schulden im Wert von 342,6 Milliarden Euro, nahm dafür aber 381 Milliarden Euro neue Schulden auf. Der Schuldenberg wuchs also um 38 Milliarden Euro.
Deutschlands Schuldenquote lag 2024 bei 63,6 Prozent
Dass die Schulden auf diese Weise nie verschwinden, ist aber nur ein geringes Problem. Entscheidend sind zwei Dinge: Erstens sollten die Zinszahlungen keinen zu großen Anteil am jährlichen Bundeshaushalt verschlingen. Vergangenes Jahr waren es 33,2 Milliarden Euro, rund 6,8 Prozent des Bundeshaushaltes. Dieses Geld fehlt für andere Ausgaben.
Damit die Zinskosten gering bleiben, ist ein gutes Rating notwendig und dafür wiederum muss die Schuldenquote tragbar bleiben. Das ist das Verhältnis von Schulden zum Bruttoinlandsprodukt. Wächst letzteres stärker als die Schulden, dann sinkt die Quote und die Schulden werden immer besser bezahlbar. In der EU sollte die Schuldenquote eines Staates unter 60 Prozent liegen. Deutschland lag 2024 bei 63,6 Prozent. Wächst das BIP bis 2035 jährlich im Schnitt um ein Prozent, würden die 500 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen diese Quote auf 68,1 Prozent steigen.
Welche Regeln gelten für die anderen Sondervermögen?
Der Infrastruktur-Fonds ist nicht das einzige große Sondervermögen, das Deutschland in den vergangenen Jahren aufgelegt hat. In der Corona-Krise gab es den Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF). Der hätte 200 Milliarden Euro aufnehmen dürfen, kam am Ende aber mit rund 41,5 Milliarden Euro aus. Für die gibt es einen Rückzahlungsplan. Von 2031 bis 2061 werden jedes Jahr 1,339 Milliarden Euro fällig. Der ist notwendig, weil der WSF mit einer Notlage begründet wurde und seine Gelder damit immer noch der Schuldenbremse unterliegen.
Seit 2022 gibt es zudem das Sondervermögen Bundeswehr, welches bis einschließlich 2027 exakt 100 Milliarden Euro aufnehmen und ausgeben darf. Hier wird anders als beim WSF vermutlich jeder Euro genutzt werden. Das Sondervermögen steht aber wegen einer Grundgesetzänderung außerhalb der Schuldenbremse. Aber auch hier gibt es einen Tilgungsplan, der im Ausführungsgesetz festgelegt ist. Er wurde damals auf Drängen der CDU/CSU aufgenommen.
Tilgungskosten erhöhen sich deutlich
Spätestens ab 2031 müssen auch die Bundeswehr-Kredite getilgt werden. Das Gesetz sagt keine konkreten Summen, nur, dass die Tilgung „in einem angemessenen Zeitraum“ erfolgen müssen. Die 31 Jahre, die der WSF dafür Zeit hat, dürften wohl auch für das Sondervermögen Bundeswehr gelten. Das wären dann rund 3,2 Milliarden Euro pro Jahr. Insgesamt erhöht das die Tilgungskosten ab 2031 auf 4,5 Milliarden Euro.
Vermutlich wird für das Sondervermögen Infrastruktur ein ähnlicher Tilgungsplan festgelegt. Wenn er ebenfalls 31 Jahre dauert und spätestens vier Jahre nach Ende des Sondervermögens beginnt, dann wären das ab 2039 Kosten von 16,1 Milliarden Euro pro Jahr. Insgesamt müssten Steuerzahler ab dann also bis 2061 rund 20,6 Milliarden Euro pro Jahr für die Schuldentilgung der Sondervermögen ausgeben. Bis 2069 wären dann noch die Rückzahlung für den Infrastrukturfonds fällig.
Folgen Sie dem Autor auf Facebook