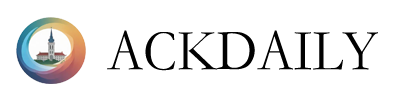Meistgelesene Artikel der Woche
Teuer für alle: Der „Redispatch“
Im Süden Deutschlands sind die Begebenheiten nun mal andere als im Norden, doch der deutsche Energiemarkt spiegelt diese simple Realität nicht wider. Wenn die norddeutschen Erzeuger viel günstigen Windstrom ins System einspeisen, bedeutet das nicht automatisch, dass dieser Strom auch in Süddeutschland physikalisch verfügbar ist.
Nicht selten führt das zu teuren Fehlanreizen: Etwa wenn ein Batteriespeicher im Allgäu sich mit Strom vollsaugt, obwohl die Netztrassen von Nord nach Süd bereits voll ausgelastet sind. Der vermeintliche Nord-Strom kommt dann teuer aus einem süddeutschen Gaskraftwerk – die Kosten für diesen sogenannten „Redispatch“ geben die Netzbetreiber an alle Verbraucher weiter.
Eine Reihe von Energie-Expertinnen und -Experten fordert daher schon lange ein Umdenken. Im deutschen System mit der einheitlichen Preiszone „werden häufig Entscheidungen getroffen, die in der Physik des Netzes nicht möglich und volkswirtschaftlich unsinnig sind“, hieß es im Juli letzten Jahres in einem vieldiskutierten Gastbeitrag von zwölf renommierten Energieökonomen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.
Der Weg müsse freigemacht werden für lokale Strompreise, die Angebot und Nachfrage auch akkurat widerspiegeln. Der Norden würde dann belohnt werden für seinen fleißigen Ausbau der Windkraft, während die Süd-Länder mehr für ihren Strom bezahlen müssten als bisher. Schätzungen gehen davon aus, dass der Preisunterschied bis zu zwei Cent pro Kilowattstunde betragen könnte.
„Skandalös und kurzsichtig“
Und spätestens hier wird die Debatte um Strompreiszonen zu einer politisch heiklen Frage. Denn gerade die süddeutschen Bundesländer lehnen die vorgeschlagene Aufteilung naturgemäß ab – und drohen mit heftigem Widerstand. Bereits vor Jahren hätten sich sechs deutsche Bundesländer zu einer sogenannten Strom-Allianz zusammengeschlossen, erinnerte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Montag im Münchner Merkur.
„Wir werden uns weiter klar gegen mehrere Strompreiszonen zur Wehr setzen und das auch gegen etwaige Bedenken der EU-Kommission aus Brüssel durchsetzen“, sagte Söder. Der Süden sei „das wirtschaftliche Leistungsherz und auch der Westen hat eine starke Wirtschaft. Eine systematische Schwächung dieser Länder wäre ein schwerer Fehler.“ Bayerns CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek nannte die Empfehlung gar „skandalös und kurzsichtig“. Wenn Bayern beim Strompreis abgetrennt werde, „drohen uns höhere Strompreise und Wettbewerbsnachteile für unsere Unternehmen.“
Und die kommende Bundesregierung? Die lehnt eine Aufteilung in verschiedene Preiszonen ab, so steht es auf Druck der Union im gemeinsamen Koalitionsvertrag mit der SPD. Am Ende könnte aber die Entscheidung in Brüssel gefällt werden, nicht in Berlin. Denn bei den europäischen Nachbarn sorgen die Eigenheiten des deutschen Strommarkts schon lange für Kritik.
Deutsche Verstopfung
Eigentlich muss jedes EU-Mitgliedsland gemäß Vorschrift aus Brüssel mindestens 70 Prozent der grenzüberschreitenden Stromleitungen für den Handel mit den Nachbarländern zur Verfügung stellen können. Ein reibungsloser innereuropäischer Stromhandel ist schließlich günstiger für alle, so die Logik.
Weil die deutschen Netze jedoch häufig mit inländischen Transfers blockiert sind, kam die Bundesrepublik nach Angaben der EU-Behörde Acer im Jahr 2023 nur auf 41 Prozent Kapazität. Offiziell muss Deutschland allerspätestens bis Ende dieses Jahres die 70-Prozent-Marke erreichen – ob das gelingt, gilt mindestens als fraglich.
earth
FOCUS online Earth widmet sich der Klimakrise und ihrer Bewältigung.
Faktenzentriert. Fundiert. Konstruktiv. Jeden Freitag als Newsletter.
Rechtstext wird geladen...
„Ich bin sauer auf die Deutschen“
Das deutsche Energiesystem treibt also auch die Stromkosten im Ausland. Die deutschen Fehlanreize – etwa der gierig einsaugende Speicher im Allgäu – sorgen zudem dafür, dass Deutschland mehr Strom aus dem Ausland importiert, als es im Idealfall eigentlich müsste. Das wurde etwa im vergangenen Dezember zum großen Problem, als Deutschland während einer Dunkelflaute massenhaft Strom aus Schweden einkaufte – was die dortigen Strompreise noch weiter in die Höhe trieb als ohnehin schon.
„Ich bin sauer auf die Deutschen“, sagte damals die schwedische Energieministerin Ebba Busch. Bei einem folgenden EU-Ministertreffen setzte Busch sogleich die Frage nach den Strompreiszonen auf die Tagesordnung. Im Juni blockierte die Ministerin sogar den Bau einer Mega-Stromleitung von Schweden nach Deutschland, weil der deutsche Strommarkt „nicht effizient funktioniert“.
Spätestens im nächsten Jahr droht der Bundesregierung also massiver Ärger aus Brüssel. Denn die EU war es auch, die den Bericht von Entso-E in Auftrag gegeben hatte. Die Analyse soll als Grundlage dienen für künftige Reformen im europäischen Stromsystem. Sollte die 70-Prozent-Marke verpasst werden, könnte die EU-Kommission als Reaktion genau jene Aufteilung in Strompreiszonen anordnen, die Union und SPD gerade erst für ausgeschlossen erklärten.
Kritik auch aus der Branche
Ein solcher Befehl, zumal von einer deutschen Kommissionschefin Ursula von der Leyen mit Parteibuch der CDU, wäre allerdings das letzte Mittel. Die europäischen Übertragungsnetzbetreiber könnten sich zuvor selbst auf eine andere Reform einigen. Deutschland könnte auch einen glaubwürdigen neuen Plan vorlegen, wie die Engpässe im deutschen Netz beseitigt werden sollen.
Ohnehin ist eine Aufteilung in Preiszonen auch innerhalb der Energiewirtschaft nicht unumstritten. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und der Verband der Automobilindustrie nannten eine Aufteilung des deutschen Strommarkts in einer gemeinsamen Stellungnahme „weder sinnvoll noch verhältnismäßig“.
Auch der europäische Windenergieverband WindEurope sieht die Vorschläge kritisch. „Es mag Argumente dafür geben, bestehende Gebotszonen auf den Strommärkten aufzuteilen“, sagte Geschäftsführer Giles Dickson. „Aber das würde die Unsicherheit über die künftigen Einnahmen von Kraftwerken erhöhen. Und das würde die Investitionen in neue erneuerbare Energien untergraben.“
„Nicht nichts, aber auch nicht gewaltig“
Die Befürchtung: Die Nachteile könnten am Ende die Vorteile überwiegen. Ein Kostenvorteil von 339 Millionen Euro pro Jahr sei „nicht nichts, aber auch nicht gewaltig“, urteilt der Stromnetz-Experte Christoph Maurer von der Beratungsfirma Consentec, selbst ein Befürworter von Strompreiszonen, auf der Plattform X. Denn der Aufwand für die Preiszonen-Reform wäre riesig: Experten rechnen mit einer Dauer von mehreren Jahren und Kosten im Milliardenbereich. Es würde also dauern, bis sich die Kosten der Umstellung amortisiert hätten.
Und bis dahin könnte sich das deutsche Netz-Problem von selbst gelöst haben, so die Hoffnung der Preiszonen-Kritiker. „Der Netzausbau ist bereits in vollen Gange“, sagt CSU-Mann Holetschek. „Bereits ab 2027 werden aber der Südostlink und ein Jahr später der Südlink dafür sorgen, dass Strom aus Überkapazitäten in Nord- und Ostdeutschland einfach nach Bayern transportiert werden kann. Damit hat sich das Problem ohnehin erledigt.“ Pikant: Die CSU hatte den Netzausbau von Nord nach Süd jahrelang bekämpft – massive Verzögerungen bei den wichtigen Stromautobahnen Südlink und Südostlink waren die Folge.
Im europäischen Ausland sind mehrere Strompreiszonen pro Land übrigens nichts Ungewöhnliches. Schweden etwa, das ebenfalls ein großes Nord-Süd-Gefälle aufweist, ist seit 2011 in vier Preiszonen aufgeteilt, genauso gibt es Preiszonen in Dänemark, Norwegen und Italien. Auch Deutschland hat schon eine Abspaltung mitgemacht: Im Jahr 2018 wurde Österreich aus dem Verbund mit Deutschland plus Luxemburg herausgelöst und in eine eigene Zone überführt.
+++ Keine Klima-News mehr verpassen - abonnieren Sie unseren WhatsApp-Kanal +++